Kim Stanley Robinson: Grüner Mars
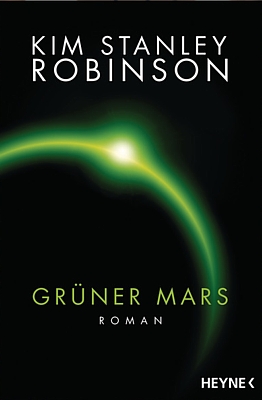
Green Mars (1993). Science-Fiction-Roman. Die deutsche Erstausgabe erschien 1997 im Wilhelm Heyne Verlag. Vorliegend ist die Neuauflage im Wilhelm Heyne Verlag vom Januar 2016. Übersetzung von Winfried Petri, durchgesehen und überarbeitet von Elisabeth Rösl. Mit einer Marskarte und einem Anhang „Der Mars – eine zweite Erde?“ von Elisabeth Rösl. Paperback, 912 Seiten.
Nach dem gescheiterten Aufstand vom Jahre 2061 sind große Teile der marsianischen Bevölkerung in den Untergrund gegangen und leben in versteckten Siedlungen, die sich vorwiegend auf der unwegsamen Südhalbkugel des Planeten verteilen. Hiroko Ai, die Gründerin der „Areophanie“-Religion, hat eine geheime Kolonie namens Zygote in einer gigantischen Höhle unter der Eiskappe des Südpols gegründet, wo sie mit ihren eigenen Eizellen und der Samenbank der „Ersten Hundert“ etliche Nachfahren gezüchtet und aufgezogen hat. Zwei ihrer Zöglinge, Nirgal und Jackie, entwickeln sich als junge Erwachsene zu tatkräftigen neuen Anführern der „Grünen“, einer Fraktion von Marsianern, die das Terraforming des Mars begrüßen, aber eine von der Erde unabhängige Entwicklung ihres Heimatplaneten wünschen. Kasei, der Sohn von John Boone und Hiroko, und der junge Dao schließen sich dagegen wie die Areologin Ann Clayborne den „Roten“ an, die das Terraforming ablehnen und die ausbeuterischen Aktivitäten der irdischen, „transnationalen“ Megakonzerne auch mit Sabotageakten bekämpfen. Die Transnationalen haben unterdessen einen neuen Weltraumlift am Äquator des Mars verankert, treiben das Terraforming weiter voran und haben ihre Macht auf dem Planeten weiter ausgebaut.
Als Sicherheitskräfte der Transnationalen Zygote angreifen und zerstören, scheint die Notwendigkeit zurückzuschlagen dringlicher denn je. Maya Toitovna, eine viel respektierte Anführerin der „Ersten Hundert“, mahnt jedoch davor, zu früh zu agieren; ihrer Meinung nach sollte der Widerstand sich erst besser organisieren und zu einem Zeitpunkt zuschlagen, der günstig ist. Unterstützt wird sie in dieser Ansicht von Art Randolph, einem Manager des transnationalen Konzerns „Praxis“, der auf den Mars geschickt wurde, um einen Kontakt zum marsianischen Untergrund herzustellen. Da der Untergrund die utopische Vision von einem neuen ökologischen und fairen Wirtschaftssystem verfolgt, wünscht „Praxis“ ein Bündnis mit ihm, da dem greisen, aber progressiven Chef des Konzerns eine ähnliche Vision sowohl für den Mars als auch für die Erde vorschwebt. Art Randolph fügt sich rasch in die Gesellschaft des Untergrunds ein und schlägt ein großes Treffen aller marsianischen Gruppierungen in Dorsa Brevia vor, einer riesigen, natürlich geformten Höhle unter einem uralten Lavastrom, um alle Kräfte miteinander abzustimmen und die grundsätzlichen politischen Richtlinien eines künftigen unabhängigen Mars auszuformulieren. Das Treffen gelingt und führt zu einer wesentlich besseren Vernetzung und Vorbereitung des marsianischen Widerstands. Dennoch dauert es noch lang, bis sich ein günstiger Zeitpunkt für die Revolution ergibt.
Dieser ist im Oktober 2127 gekommen, als auf der Erde infolge des Klimawandels ein gigantischer Teil der antarktischen Eiskappe ins Meer abrutscht, schmilzt und den Meeresspiegel dramatisch ansteigen lässt. Katastrophale Überschwemmungen führen auf der Erde zu einer weltweiten Krise, die die Macht der Transnationalen massiv schwächt. Daraufhin erheben sich die Marsianer überall auf dem roten Planeten gegen die bewaffneten Sicherheitskräfte der Konzerne, um ihre Heimatwelt endlich vom Joch der Erde zu befreien . . .
Utopischer Leerlauf: Der grüne Mars bleibt rot
Mit Grüner Mars setzte Kim Stanley Robinson (geb. 1952) seine monumentale Marstrilogie, die er mit Roter Mars (1992) begann, fort; ihren Abschluss fand die Trilogie mit dem Band Blauer Mars (1996). Die Kritikpunkte, die ich in meiner Besprechung zu Roter Mars angesprochen habe, müssen leider auch der Fortsetzung entgegengehalten werden. Das grundlegendste Problem betrifft den Umfang des Romans. Masse geht nur selten einher mit Klasse, und Kim Stanley Robinson ist definitiv kein Romancier vom Kaliber eines Leo Tolstoi oder J. R. R. Tolkien. Seine erzählerischen und sprachlichen Fähigkeiten sind arg begrenzt und rechtfertigen daher in keiner Weise die über 900 Seiten, auf die er jeden der drei Bände ausgewalzt hat. Quälend langatmig wird über Hunderte von Seiten hinweg fast nichts (!) erzählt.
In unerträglicher Wiederkehr und wenig anschaulicher Umständlichkeit werden ständig die stinklangweiligen Reisen der verschiedenen Protagonisten über die Marsoberfläche geschildert, die mit Marsrovern unterwegs sind, um in irgendeiner Siedlung eine der anderen Hauptfiguren zu treffen – meist nur, um mit ihr über das Terraforming oder die künftige Marsgesellschaft zu diskutieren. Auf eine Fahrt über den Planeten folgt die nächste, immer und immer wieder, bis schließlich der Leser das Gefühl bekommt, dass ihm nun auch tatsächlich der letzte aller Canyons, der letzte aller Meteoritenkrater und schließlich auch der letzte aller Kieselsteine auf dem Mars vorgeführt wurde.
Robinson aber geht es offensichtlich genau darum: Er ist fasziniert von den prachtvollen Fotos, die die zahlreichen Marssonden in den letzten Jahren vom roten Planeten gemacht haben und die die Fantasie beflügeln, und verliebt in die marsianischen Kraterlandschaften, Bruchgräben und ausgetrockneten Flusssysteme. Und nun lebt er diese Faszination zügellos aus, imaginiert zahllose Reisen durch diese Landschaften und glaubt wohl, das so packend hinzubekommen, dass es auch den Leser fesseln würde. Mitnichten: Ein schicker Bildband vom Mars vermittelt die Faszination der marsianischen Landschaften allemal besser. Da Robinson es versäumt, sein Marspanorama mit einer spannenden Erzählung und originellen Figuren zu verbinden und er viel zu langatmig schildert, bleibt das Werk letztlich blass und konturlos. Und irgendwann wird es dem arg auf die Geduldsprobe gestellten Leser auch schnurzpiepegal.
Ein anderes zentrales Thema, das Robinson schildern will, ist das fortschreitende Terraforming des Mars. Für das Ziel, den Planeten zu einem lebensfreundlicheren Ort zu machen, werden drei Wege beschritten: die allmähliche Verdichtung und Aufwärmung der Marsatmosphäre; die Besiedlung der Oberfläche mit genmanipulierten, frostresistenten Flechten, Moosen und Krummhölzern, die eine erste Vegetation auf dem Mars etablieren sollen; schließlich das Emporfördern des Wassers, das sich tief im Mars befindet und das auf der Oberfläche zu wachsenden Eismeeren gefriert. Die professionellen Einschätzungen darüber, wieviel Zeit die verschiedenen Prozesse des Terraformings in Anspruch nehmen würden, gehen weit auseinander – manche Forscher rechnen mit nur hundert Jahren, andere mit mehreren Jahrtausenden. So mag Robinsons Vision vom raschen Terraforming zu optimistisch wirken, doch muss dem Autor hier zugute gehalten werden, dass ihm die sachliche Darstellung dieser Vision recht gut gelingt. Seine mittels großer Bohrtürme verwirklichten Eismeere bleiben unglaubwürdig, aber wie die Flechten und Moose langsam die steinigen Ebenen und Canyons des Mars erobern und dabei den immer noch eisigen Temperaturen trotzen, schildert Robinson im Rahmen seiner Reiseberichte immerhin anschaulich und interessant (z. B. im Kapitel „Ein weiter Weg“ ab S. 167 oder im Kapitel „Der Wissenschaftler als Held“ ab S. 205). Der Mars bleibt dabei weitgehend rot, denn auch wenn die botanischen Erfolge beachtlich sind, sind sie andererseits noch weit von einem wirklich „grünen“ Mars entfernt.
Doch leider setzen sich alle anderen Probleme, die schon Roter Mars betrafen, auch in Grüner Mars fort. Die ökonomische und technische Machbarkeit der Kolonisation des Planeten interessiert Robinson kaum und wird einfach vorausgesetzt, insbesondere werden alle technischen Hindernisse im Handumdrehen mit sich selbst replizierenden Maschinen und KIs gelöst. Auch die Menschen des sogenannten „Untergrunds“, sozusagen die Regimekritiker, die sich unglaubwürdigerweise über Jahrzehnte hinweg erfolgreich vor den Autoritäten in geheimen Siedlungen verstecken können, verfügen über praktisch unbegrenzte technologische Ressourcen. Alle Probleme des Überlebens auf dem Mars, insbesondere die hohe Strahlenbelastung, werden einfach ignoriert oder bagatellisiert (z. B. auf S. 453, wo Coyote über die Strahlung scherzt, die er bisher schon auf seinen langen Reisen auf dem Mars abbekommen habe). Da hilft es auch nicht, dass der Autor zu Beginn seines Romans Simon, einen der Ersten Hundert, aus Alibigründen den Krebstod sterben lässt.
Demgegenüber bramarbasiert Robinson nach wie vor über einen neuen, postkapitalistischen Weg, den die marsianische Gesellschaft in bewusster Abkehr von ihren verdorbenen irdischen Wurzeln einschlagen will. Das bereits in Roter Mars angestoßene Thema verharrt jedoch im Leerlauf; konkret wird es auch in Grüner Mars nicht. Das Wenige, was der Leser über diesen „neuen Weg“ erfährt, wirkt eher primitiv und rückständig. So pflegt der Untergrund ein Tauschhandelsystem, in dem Wasserstoffperoxid und „Geschenke“ als Währungen dienen (vgl. S. 531). Die lebensnotwendigen Dinge stehen hingegen allen jederzeit zur Verfügung und bedürfen keiner Bezahlung. Diese schwammige Vorstellung einer Kollektivwirtschaft, die ein klares Bekenntnis zu kommunistischen Modellen scheut, wird mit einem hanebüchenen Okkultismus vermischt, der allen Ernstes als ein Mittel gesehen wird, mit dem die grundschlechten egoistischen Einflüsse des „irdischen“ Menschen ausgemerzt werden könnten. Hirokos neue, marsianische Religion der „Areophanie“, die die Lebenskraft (viriditas) und den Planeten selbst anbetet, wird zum zentralen Bindemittel der marsianischen Menschen. Fast alle schließen sich begeistert dieser neuen Religion an, als ließen sich uralte Traditionen und Denkweisen einfach so beiseite schieben und vergessen. Dass die Areophanie sich als ein nahezu steinzeitliches Gemisch von Mutterkult und archaischen Ritualen präsentiert, in denen Hiroko gelegentlich als splitternackte, grün angemalte Muttergöttin auftritt (S. 565 ff.), scheint niemandem auf dem Mars – immerhin Wissenschaftler, Ingenieure, Spezialisten, digital natives – besonders zu stören.
Robinson hat mit der gentechnologischen „gerontologischen Behandlung“ seine Protagonisten praktisch unsterblich gemacht, um sie in allen drei Bänden als Dramatis Personae zu verwenden. Das wächst sich in Grüner Mars zunehmend zu einem massiven narrativen Problem aus. Nach wie vor sind Robinsons „Erste Hundert“ die wichtigsten Protagonisten, die immer noch die Geschicke auf dem Mars entscheidend lenken. Der Leser aber fragt sich, wie das überhaupt möglich sein soll: uralte Greise, die noch immer revolutionäres Feuer in sich haben und von den Jungen in ihren Machtpositionen nicht abserviert, sondern ungebrochen bewundernd respektiert werden? An einigen wenigen Stellen thematisiert Robinson auch selbst diese unglaubwürdige Diskrepanz: „Maja setzte sich auf eine Bank ihren alten Gefährten gegenüber und sah sie grimmig an. Gefleckte, runzlige alte Knacker und Vetteln“ (S. 619), heißt es da selbstkritisch. Und: „Peter und Kasei und der Rest der Nisei-Generation näherten sich den Siebzigern und hätten im regulären Lauf der Dinge längst die Anführer ihrer Welt sein müssen. Aber sie standen immer noch im Schatten ihrer nicht sterbenden Eltern“ (S. 620 f.). Es ist schon peinlich, wenn der Autor selbst auf die erzählerischen Schwächen seines Konstrukts verweist und dann aber keine einleuchtende, glaubwürdige Antwort auf diese Schwächen anbieten kann.
Zuguterletzt kann ich es leider nicht versäumen, eine weitere höchst peinliche Sexszene zu vermelden, von denen es in der Literatur ja nur so wimmelt. Sie wirft ein weiteres Schlaglicht auf Robinsons dürftige poetische Fähigkeiten: Als Nirgal und Jackie zum ersten Mal Sex im Freien auf dem eisig kalten Marsboden haben und Nirgal auf seiner Partnerin liegt, „war [es], als stieße er direkt in einen starken, weiblichen, zuckenden Planeten. Lebender Fels“ (S. 498). Ein Kommentar erübrigt sich.
Grüner Mars erweist sich somit als unerträglich zähe, unerträglich langweilige und handlungsarme Fortsetzung von Roter Mars, die außer der anschaulichen Schilderung der Veränderungen, die das Terraforming auf dem Mars hervorbringen könnte, nichts zu bieten hat. Das ist definitiv zuwenig, sogar dann, wenn das Buch nur ein Drittel seines Umfangs hätte.
© Michael Haul
Veröffentlicht auf Astron Alpha am 18. Januar 2019
